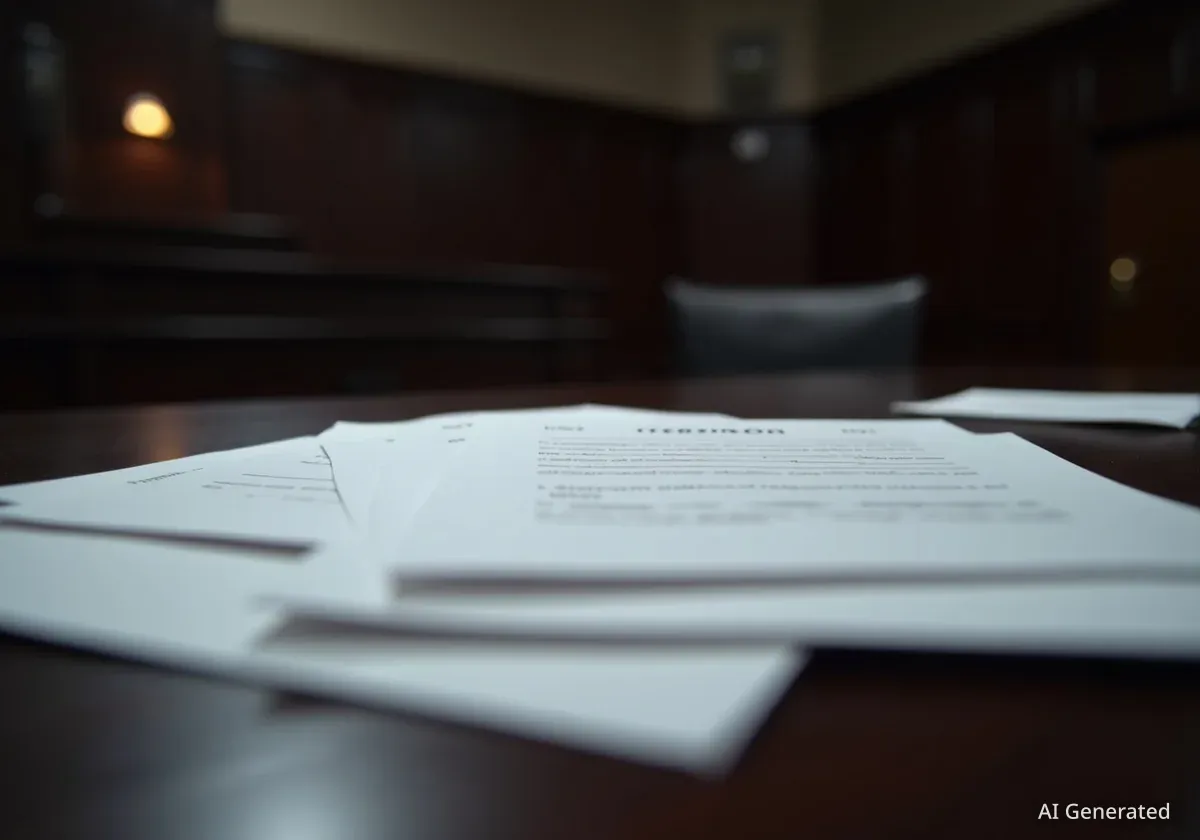Berns Sicherheitsdirektor Alec von Graffenried warnt nach jüngsten Unruhen während einer propalästinensischen Demonstration in der Stadt vor verstärkten Überwachungsmassnahmen. Er betont, dass solche Massnahmen die Grundfreiheiten aller Bürger gefährden könnten.
Wichtigste Erkenntnisse
- Berns Sicherheitsdirektor lehnt neue Überwachungsmassnahmen ab.
- Er betont die Bedeutung einer konsequenten Anwendung bestehender Gesetze.
- Frühere Versuche, die Demonstrationsvorschriften in Bern zu verschärfen, scheiterten.
- Die Debatte folgt auf eine propalästinensische Demonstration mit gewalttätigen Auseinandersetzungen.
Berner Behörden debattieren Sicherheit nach jüngsten Protesten
Am 11. Oktober eskalierte eine propalästinensische Demonstration in Bern in gewalttätige Auseinandersetzungen und Sachbeschädigungen. Diese Ereignisse haben eine stadtweite Debatte über die öffentliche Sicherheit und die angemessene Reaktion auf extremistische Gewalt ausgelöst. Mehrere politische Gruppierungen, insbesondere aus konservativen Kreisen, haben strengere Gesetze und erweiterte Überwachungsbefugnisse für Polizei und Nachrichtendienste gefordert.
Alec von Graffenried, der aktuelle Sicherheitsdirektor der Stadt Bern, warnt vor übereilten Entscheidungen. Er ist der Ansicht, dass die Umsetzung restriktiverer Massnahmen die Freiheiten aller Einwohner gefährden würde, nicht nur die potenzieller Straftäter. Seine Haltung unterstreicht eine langjährige Spannung zwischen Sicherheitsbedürfnissen und individuellen Freiheiten innerhalb der Stadt.
Wichtiger Fakt
Der Berner Stadtrat hat in den letzten 15 Jahren mehrfach Vorschläge zur Verschärfung der Demonstrationsvorschriften abgelehnt, darunter einen Artikel, der es den Behörden erlaubt hätte, Personen zu entfernen, die sich weigerten, eine Versammlung zu verlassen.
Freiheit und Sicherheit: Ein heikles Gleichgewicht
Von Graffenried vertritt in diesen Fragen eine liberale Perspektive. Er erklärt, dass er solche Massnahmen kritisch sieht, da eine verstärkte Überwachung alle betreffen würde. Er argumentiert, dass der Versuch, einzelne Verdächtige in grossen Versammlungen von Tausenden von Menschen zu identifizieren, unverhältnismässig sei.
„Ich stehe in solchen Fragen immer auf der liberalen Seite und betrachte solche Massnahmen kritisch“, erklärte von Graffenried. „Freiheit hat ihren Preis. Sie hat zum Beispiel den Preis, dass es keine totale Sicherheit gibt.“
Er verwies auf die Fichenaffäre von 1989, einen Skandal, der die weit verbreitete geheime Überwachung Schweizer Bürger umfasste. Dieses historische Ereignis erinnert an das Potenzial staatlicher Übergriffe und die Bedeutung des Schutzes bürgerlicher Freiheiten. Der Sicherheitsdirektor ist der Ansicht, dass die Gesellschaft abwägen muss, wie viel Freiheit sie für die Sicherheit vor den Handlungen einiger weniger zu opfern bereit ist.
Historischer Kontext: Die Fichenaffäre
Die Fichenaffäre bezieht sich auf einen Skandal, der 1989 in der Schweiz ausbrach. Es wurde bekannt, dass die Schweizer Bundespolizei und kantonale Behörden Hunderttausende von Akten über Bürger, politische Aktivisten und Organisationen heimlich angelegt hatten. Diese Massenüberwachungsaktion löste eine weit verbreitete öffentliche Empörung aus und führte zu bedeutenden Reformen der Schweizer Nachrichtendienstgesetze, die den Schutz der Privatsphäre und der Bürgerrechte betonten.
Anwendung bestehender Gesetze: Der bevorzugte Ansatz
Obwohl von Graffenried die gewalttätigen Handlungen während der Demonstration scharf verurteilt, sieht er strengere Gesetze nicht als primäre Lösung. Stattdessen plädiert er für die konsequente und rigorose Anwendung bestehender rechtlicher Rahmenbedingungen. Er ist der Ansicht, dass die aktuellen Gesetze ausreichen, wenn sie ordnungsgemäss durchgesetzt werden.
In Bern, einer Stadt mit einer historisch linksgerichteten politischen Landschaft, stiessen Vorschläge für strengere Vorschriften oft auf erheblichen Widerstand. Von Graffenried wies darauf hin, dass Versuche, die Versammlungsbestimmungen zu ändern, in den letzten anderthalb Jahrzehnten wiederholt abgelehnt wurden. Dazu gehörte ein vorgeschlagener Artikel, der den Behörden die Befugnis gegeben hätte, Personen zu entfernen, die sich weigerten, eine Demonstration nach Aufforderung zu verlassen.
Unterschiedliche Ansichten unter Berner Politikern
Von Graffenrieds Position steht im Gegensatz zu der seines Vorgängers, Nationalrat Reto Nause. Nause, Mitglied der Mitte-Partei und bis 2024 ehemaliger Sicherheitsdirektor von Bern, ist ein prominenter Befürworter härterer Sicherheitsmassnahmen. Er hat eine engere Überwachung extremistischer Gruppen, insbesondere der gewalttätigen linken Szene, gefordert.
Nause schlägt vor, dass genehmigungspflichtige Massnahmen wie Telefonüberwachung auf politisch extreme Gruppen ausgeweitet werden sollten. Diese Meinungsverschiedenheit unterstreicht die anhaltende Debatte in den Berner politischen Kreisen über das Gleichgewicht zwischen Sicherheit und individuellen Rechten.
„Die gewaltextremistische linke Szene muss endlich engmaschig überwacht werden“, erklärte Reto Nause nach den Unruhen.
Trotz dieser unterschiedlichen Ansichten fühlt sich von Graffenried in seiner Rolle nicht bedroht. Er bemerkte, dass Reto Nause die Aufgabenteilung respektiere. Nause amtiert nun als Präsident der Sicherheitsallianz, wo er deren Vorschläge vertritt.
Unterstützung für Unternehmen und zukünftige Überlegungen
Die konservativen Forderungen gehen über die Sicherheit hinaus und umfassen auch die wirtschaftliche Unterstützung betroffener Unternehmen. Nauses Partei hat einen Härtefallfonds für Unternehmen vorgeschlagen, die von der Demonstration betroffen sind, hauptsächlich finanziert von der Stadt. Von Graffenried äusserte sich vorsichtig zu dieser Idee.
Er deutete an, dass die Stadtregierung den Bedarf an einem solchen Fonds untersuchen und prüfen würde, wie er umgesetzt und finanziert werden könnte, wenn es klare Signale von den Betroffenen gäbe. Er wies jedoch auch darauf hin, dass Sachschäden durch Vandalismus in der Regel gut durch Gebäudeversicherungen und private Versicherer abgedeckt sind.
Diese Diskussion unterstreicht die vielfältigen Herausforderungen, denen Bern gegenübersteht, während die Behörden nach den jüngsten Unruhen öffentliche Sicherheitsbedenken, bürgerliche Freiheiten und wirtschaftliche Auswirkungen bewältigen müssen.