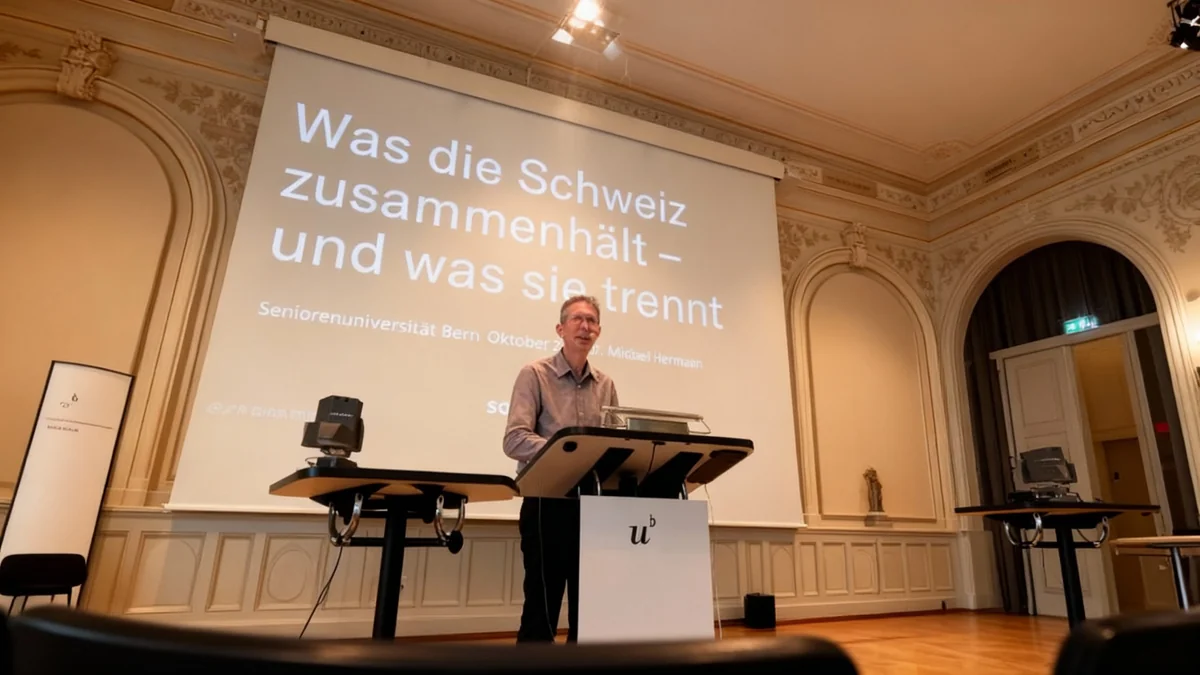Eine aktuelle Studie des Forschungsinstituts Sotomo, bekannt als «Generationenbarometer», zeigt eine sich wandelnde Wahrnehmung der Generationenbeziehungen in der Schweiz. Während jüngere Menschen zunehmend eine Kluft empfinden, deutet der Politikgeograph Michael Hermann an, dass die Realität nuancierter ist und betont andere gesellschaftliche Bruchlinien.
Wichtige Erkenntnisse
- Jüngere Generationen nehmen zunehmend eine Kluft zwischen Jung und Alt in der Schweiz wahr.
- Michael Hermann argumentiert, dass kein tiefer Generationenkonflikt existiert, und hebt andere gesellschaftliche Spaltungen als prominenter hervor.
- Das «Jetzt-bin-ich-dran-Prinzip» beeinflusst jüngste Volksabstimmungen, angetrieben von älteren Demografien.
- Globalisierung, Digitalisierung und Leistungsdruck tragen zur gesellschaftlichen Belastung bei.
- Hermann ermutigt jüngere Bürger, sich aktiver an der direkten Demokratie zu beteiligen.
Wandelnde Wahrnehmung der Generationenbeziehungen
Das «Generationenbarometer» ist eine repräsentative Studie, die vom Generationenhaus Bern in Auftrag gegeben wird. Sie wird in regelmässigen Abständen vom Forschungsinstitut Sotomo durchgeführt. Dieses Jahr ist die dritte Auflage der Studie, nach früheren Berichten in den Jahren 2020 und 2021.
Für die Studie 2025 befragte Sotomo 2.754 Personen ab 18 Jahren in der Deutsch- und Westschweiz. Die Ergebnisse wurden statistisch gewichtet, um sicherzustellen, dass sie repräsentativ für die Wohnbevölkerung sind. Die Ergebnisse zeigen eine bemerkenswerte Schwerpunktverschiebung im Vergleich zu den Vorjahren.
Studien-Snapshot
- Teilnehmende: 2.754 Personen ab 18 Jahren
- Regionen: Deutsch- und Westschweiz
- Frequenz: Dritte Auflage (nach 2020, 2021)
Im Jahr 2020 war die Vermögensschere ein Hauptanliegen. Der Fokus verschob sich 2021 auf COVID-19-Massnahmen. Dieses Jahr zeigte die Umfrage, dass viele, insbesondere jüngere Menschen, wachsende Interessenskonflikte zwischen älteren und jüngeren Generationen wahrnehmen. Während nur jeder fünfte über 45-Jährige eine signifikante Generationenkluft identifiziert, glaubt eine Mehrheit der 18- bis 25-Jährigen, dass Jung und Alt in der Schweiz auseinanderdriften.
Jenseits der Generationenkluft
Während eines Vortrags an der Seniorenuniversität Bern präsentierte der Politikgeograph und Sotomo-Mitbegründer Michael Hermann seine Analyse. Er spielte die Idee eines tiefen Generationenkonflikts in der Schweiz herunter. Hermann erklärte: «Einen tiefen Graben gibt es nicht.» Er argumentierte, dass andere gesellschaftliche Bruchlinien von der Bevölkerung stärker empfunden werden.
«Einen tiefen Graben gibt es nicht. Andere gesellschaftliche Spaltungen werden stärker wahrgenommen.»
Michael Hermann, Politikgeograph
Die Studie hebt andere Bereiche der wahrgenommenen gesellschaftlichen Spaltung hervor. Zum Beispiel glauben 66 Prozent der Befragten, dass die Schweiz politisch zwischen Rechts (SVP) und Links (SP/Grüne) auseinanderdriftet. Weitere 65 Prozent sehen eine wachsende Kluft zwischen Arm und Reich. Eine signifikante Mehrheit von 51 Prozent nimmt eine Kluft zwischen Stadt und Land wahr, und 43 Prozent empfinden, dass die Interessenskonflikte zwischen Schweizer Bürgern und Ausländern zunehmen.
Die Rolle der Medien bei der politischen Polarisierung
Hermann deutet an, dass die politische Spaltung zwischen Rechts und Links massgeblich von Mediendynamiken beeinflusst wird. Politiker fühlen sich unter intensiver Medienbeobachtung gezwungen, sich zu differenzieren und extremere Positionen einzunehmen. Er vermutet, dass sie ohne diese ständige Medienaufmerksamkeit eher zu Kompromissen neigen würden. Hermann bemerkte auch einen Trend, bei dem die Regierungen und Parlamente grosser Städte wie Bern, Zürich und Basel zunehmend als radikal wahrgenommen werden.
Die anhaltende Kohäsion der Schweiz
Trotz dieser verschiedenen wahrgenommenen Spaltungen glaubt Hermann, dass die Schweiz nicht auseinanderfällt. Er verweist auf die einzigartige direkte Demokratie des Landes als verbindende Kraft. Unterschiedliche Konfliktlinien führen oft zu neuen Allianzen, insbesondere nach Volksabstimmungen. Die Verlierer von gestern können die Gewinner von morgen werden und umgekehrt. Diese Dynamik stärkt den sozialen Zusammenhalt und das öffentliche Vertrauen in das Urteilsvermögen der Wählerschaft.
Die Rolle der direkten Demokratie
Das Schweizer System der direkten Demokratie ermöglicht es den Bürgern, über Gesetzesvorschläge und Verfassungsänderungen abzustimmen. Dieser Prozess fördert das Engagement und kann zu wechselnden Allianzen führen, wodurch eine tiefe gesellschaftliche Fragmentierung verhindert wird.
Hermann findet es akzeptabel, dass Bürger nicht jedes Detail komplexer Vorschläge verstehen. Er glaubt, dass der Prozess der direkten Demokratie selbst entscheidend ist. Medien und öffentlicher Diskurs spielen eine wichtigere Rolle bei der Meinungsbildung als ein vollständiges Verständnis jedes Themas. Der starke soziale Zusammenhalt der Schweiz, trotz ihrer sprachlichen, kulturellen und konfessionellen Vielfalt, ist ein Beweis für dieses System. Hermann führt dies teilweise auf das Verständnis der Arbeitnehmer für wirtschaftliche Belange zurück, das sich wiederholt in Volksabstimmungen gezeigt hat.
Vom Optimismus zum Pessimismus: Ein Generationenwechsel
Das jüngste «Generationenbarometer» zeigt eine bemerkenswerte Verschiebung der Zukunftsaussichten. Jüngere Generationen sind deutlich pessimistischer in Bezug auf die Zukunft als ältere Befragte. Lebenszufriedenheit und Vertrauen in die eigene Zukunft scheinen abzunehmen, obwohl die Generation Z theoretisch mehr Spielraum für die aktive Gestaltung ihres Lebens hat als andere Altersgruppen. Hermann beklagt, dass junge Menschen diese Chancen oft nicht nutzen, insbesondere bei Volksabstimmungen.
Dieser Trend steht in scharfem Kontrast zur Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die späten 1960er Jahre. In dieser Zeit befeuerten wirtschaftliche und technologische Fortschritte einen grösseren Optimismus unter der Jugend. Sie sahen und nutzten Chancen im allgemeinen Nachkriegsboom. Die 68er-Revolte markierte einen Wendepunkt, wobei sich Optimismus und Pessimismus in den 1970er Jahren ausglichen. Seit der COVID-19-Pandemie hat sich die vorherrschende Überzeugung durchgesetzt, dass die ältere Mittelschicht ein leichteres Leben hat als jüngere Generationen, die höheren Erwartungen gegenüberstehen.
Das «Jetzt-bin-ich-dran-Prinzip»
Hermann identifiziert ein Phänomen, das er das «Jetzt-bin-ich-dran-Prinzip» nennt, als Schlüsselfaktor, der jüngste Volksabstimmungen beeinflusst. Dieses Prinzip, so argumentiert er, war bei mehreren wichtigen Referenden entscheidend. Globalisierung, Digitalisierung und die Exzesse der Leistungsgesellschaft haben den Druck auf arbeitende Individuen erhöht und zu dieser Denkweise beigetragen.
So mobilisierte beispielsweise die ältere Mittelschicht erheblich, um über die 13. AHV-Rente abzustimmen. Ähnlich wurde die Abstimmung zur Abschaffung des Eigenmietwerts von Hausbesitzern, Wohnungseigentümern und jenen, die auf Wohneigentum hofften, vorangetrieben. Hermann deutet an, dass die Solidarität mit weniger wohlhabenden Personen und mit jüngeren Generationen bei diesen Entscheidungen in den Hintergrund gedrängt wurde. Diese Entwicklung wurde durch Ereignisse wie die Swissair-Grounding, hohe Managergehälter und erhöhten Einwanderungsdruck beeinflusst.
Viele Wähler empfinden nun implizit, dass andere in den letzten Jahren profitiert haben und dass sie nun an der Reihe sind. Das «Generationenbarometer» spiegelt diese Stimmungsverschiebung deutlich wider. Neue Ängste vor potenziellen Verlusten behindern Risikobereitschaft und Innovation, insbesondere bei der jüngeren Generation.
Ein Appell an das Engagement der Jugend
Hermanns Empfehlungen an die Mitglieder der Seniorenuniversität Bern richten sich primär an jüngere Generationen. Er fordert sie auf, sich aktiver an der direkten Demokratie durch Abstimmungen und Wahlen zu beteiligen. Er glaubt, dass eine offene Debatte den Diskurs über divergierende Interessen fördert und die Entstehung neuer Gräben verhindert.
Darüber hinaus plädiert Hermann für eine Senkung des Stimmrechtsalters auf 16 Jahre. Er ist der Meinung, dass es an der Zeit ist, junge Menschen früher in politische Entscheidungen einzubeziehen. Er weist auch Ängste vor neuen Abkommen mit der Europäischen Union zurück und erklärt: «Diese fördern Innovation. Und wenn es um Innovation geht, sind wir Schweizer nicht die Schlechtesten.»