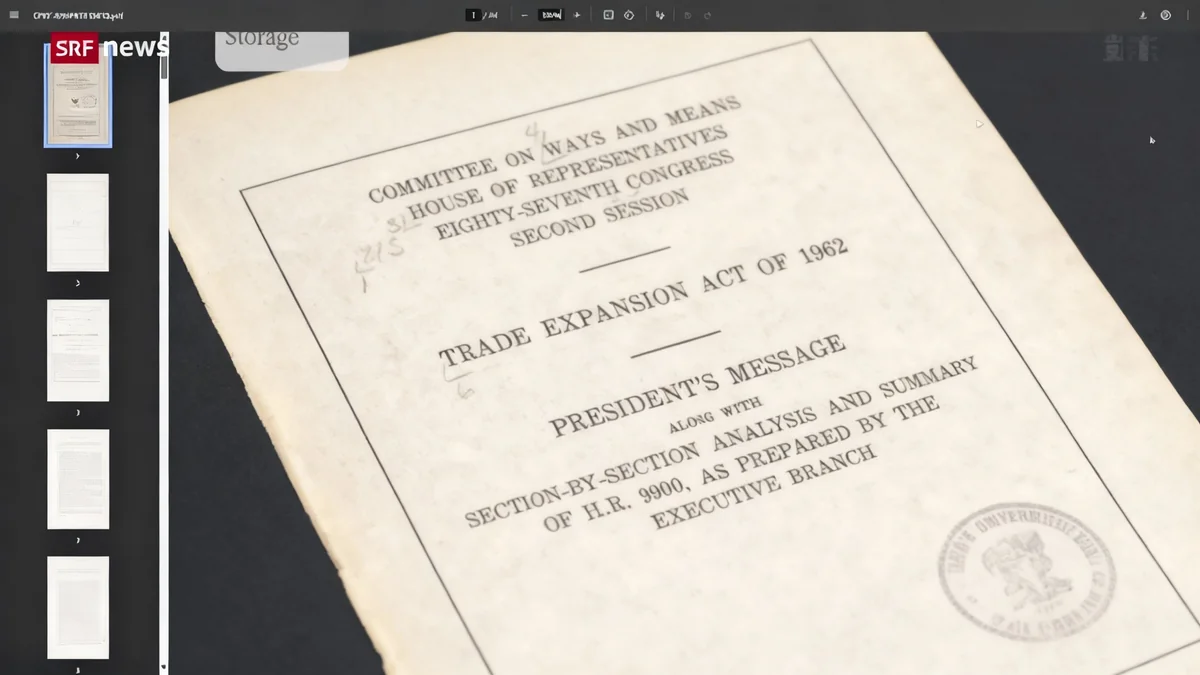Der Schweizer Bundesrat hat ein Vernehmlassungsverfahren für zwei Vorschläge eingeleitet, die darauf abzielen, Elektrofahrzeuge (EVs) ab 2030 zu besteuern. Diese Massnahmen sollen eine stabile Finanzierung der Strasseninfrastruktur gewährleisten, da die Einnahmen aus der Mineralölsteuer mit der zunehmenden Verbreitung von Elektrofahrzeugen zurückgehen. Die Vorschläge halten am Prinzip fest, dass diejenigen, die die Strassen nutzen, zu deren Unterhalt beitragen sollen.
Wichtige Erkenntnisse
- Der Schweizer Bundesrat schlägt zwei EV-Steuermodelle vor.
- Ziel ist es, die entgangenen Einnahmen aus der Mineralölsteuer zu kompensieren.
- Die Vorschläge umfassen eine kilometerabhängige Gebühr und eine Ladestromsteuer.
- Die neue Besteuerung ist für den Beginn im Jahr 2030 geplant.
- Eine Verfassungsänderung und eine Volksabstimmung könnten erforderlich sein.
Finanzierungsmodell für die Strasseninfrastruktur
Derzeit wird die eidgenössische Strasseninfrastruktur der Schweiz vollständig von ihren Nutzern finanziert. Die Haupteinnahmequelle hierfür ist die Mineralölsteuer. Diese Steuer speist den Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds (NAF) und den Spezialfonds für den Strassenverkehr (SFSV). Etwa die Hälfte der Grundmineralölsteuer fliesst zudem in den allgemeinen Bundeshaushalt.
Besitzer von Elektrofahrzeugen zahlen diese spezifische Steuer jedoch nicht. Da immer mehr Autofahrer auf Elektrofahrzeuge umsteigen, sinken die Einnahmen aus der Mineralölsteuer. Dieser Rückgang führt zu einer Finanzierungslücke für die Strasseninstandhaltung und -entwicklung.
Fakt: Mineralölsteuer
Die Mineralölsteuer ist die grösste einzelne Finanzierungsquelle für die Strasseninfrastruktur in der Schweiz. Sie stellt sicher, dass diejenigen, die von den Strassen profitieren, zu deren Bau und Unterhalt beitragen.
Behebung von Einnahmeausfällen
Der Bundesrat will diese Einnahmeverluste durch die Einführung einer vergleichbaren Steuer für Elektrofahrzeuge ausgleichen. Diese Strategie soll das derzeitige Finanzierungsniveau sichern und das etablierte Verursacherprinzip aufrechterhalten. Dieses Prinzip besagt, dass diejenigen, die die Strasseninfrastruktur nutzen, für deren Finanzierung verantwortlich sind.
Die Aufrechterhaltung der finanziellen Stabilität der Strassennetze ist entscheidend für die Schweizer Wirtschaft und das tägliche Leben. Strassen erleichtern Handel, Tourismus und den täglichen Pendlerverkehr. Die Sicherstellung ihrer Qualität erfordert eine konsequente Finanzierung.
Die Notwendigkeit neuer Einnahmequellen
Der Übergang zur Elektromobilität ist ein positiver Schritt für die Umwelt. Er stellt jedoch eine Herausforderung für traditionelle Finanzierungsmodelle dar. Neue, gerechte Wege zur Finanzierung der Infrastruktur zu finden, ist langfristig unerlässlich. Die Vorschläge des Bundesrates gehen dieses aufkommende Problem direkt an.
Zwei vorgeschlagene Besteuerungsmodelle
Um sein Ziel zu erreichen, hat der Bundesrat eine Vernehmlassung zu zwei gleichwertigen Vorschlägen eröffnet. Diese Vorschläge bieten unterschiedliche Methoden zur Besteuerung von Elektrofahrzeugen.
Variante 1: Kilometerabhängige Gebühr
Die erste Option ist eine kilometerabhängige Gebühr. Bei diesem System würden Fahrzeughalter eine Gebühr basierend auf den in der Schweiz gefahrenen Kilometern entrichten. Der Tarif pro Kilometer würde vom Fahrzeugtyp und dessen Gesamtgewicht abhängen. Schwerere Fahrzeuge würden einen höheren Tarif verursachen.
„Der Tarif pro Kilometer würde vom Fahrzeugtyp und dessen Gesamtgewicht bestimmt – je schwerer das Fahrzeug, desto höher der Tarif“, so das Bundesamt für Strassen (ASTRA).
Für ein durchschnittliches Auto beträgt der vorgeschlagene Tarif etwa 5.4 Rappen pro Kilometer. Dieses Modell verknüpft die Kosten direkt damit, wie stark ein Fahrzeug das Strassennetz nutzt.
Kontext: Verursacherprinzip
Das Verursacherprinzip ist ein grundlegendes Konzept in der Schweizer Infrastrukturfinanzierung. Es stellt sicher, dass die Kosten öffentlicher Dienstleistungen, wie Strassen, von denjenigen getragen werden, die davon profitieren. Dieses Prinzip fördert Fairness und eine effiziente Ressourcenallokation.
Variante 2: Ladestromsteuer
Die zweite Option ist eine Steuer auf den Strom, der zum Laden von Elektrofahrzeugen in der Schweiz verwendet wird. Diese Steuer würde auf die an Ladestationen gelieferte Strommenge erhoben. Sie würde sowohl an öffentlichen als auch an privaten Ladepunkten erhoben.
Der vorgeschlagene Tarif für diese Variante beträgt 22.8 Rappen pro Kilowattstunde (kWh). Dieser Satz würde einheitlich gelten, unabhängig vom Fahrzeugtyp. Dieser Ansatz besteuert den Energieeinsatz und nicht die zurückgelegte Strecke.
Verfassungsänderung und Volksabstimmung
Der Bundesrat beabsichtigt, die Einnahmen aus dieser neuen Steuer auf die gleiche Weise wie die Mineralölsteuer zu verwenden. Das bedeutet, die Mittel würden dem Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds (NAF), dem Spezialfonds für den Strassenverkehr (SFSV) – der Beiträge an die Kantone und den Bahninfrastrukturfonds (BIF) umfasst – und dem allgemeinen Bundeshaushalt zufliessen.
Eine solche Umverteilung von Mitteln erfordert eine Änderung der Bundesverfassung. Jede Verfassungsänderung muss einer nationalen Volksabstimmung unterbreitet werden. Das bedeutet, die Schweizer Bürgerinnen und Bürger haben das letzte Wort über das vorgeschlagene Steuersystem.
Die Vernehmlassungsfrist für diese Vorschläge hat nun begonnen. Sie läuft bis zum 9. Januar 2026. Der Bundesrat strebt an, dass die Besteuerung von Elektrofahrzeugen im Jahr 2030 beginnt.
Auswirkungen auf die Bundesfinanzen
Das aktuelle Finanzierungsmodell hat der Schweiz jahrzehntelang gute Dienste geleistet. Der Aufstieg der Elektrofahrzeuge erfordert jedoch Anpassungen. Die Sicherung alternativer Einnahmequellen ist entscheidend, um zukünftige Defizite bei den Infrastrukturausgaben zu vermeiden. Die vorgeschlagene Verfassungsänderung spiegelt die langfristige Vision für eine nachhaltige Finanzierung wider.
- NAF: Unterstützt Nationalstrassen und städtische Agglomerationsprojekte.
- SFSV: Finanziert spezifische Strassenverkehrsinitiativen, einschliesslich kantonaler Beiträge.
- BIF: Erhält Beiträge, was die Vernetzung der Verkehrsinfrastruktur unterstreicht.
- Allgemeiner Bundeshaushalt: Ein Teil unterstützt breitere Regierungsfunktionen.
Ausblick auf 2030
Das Umsetzungsziel 2030 bietet einen klaren Zeitplan für diese bedeutenden Änderungen. Der Vernehmlassungsprozess ermöglicht es verschiedenen Interessengruppen, darunter Fahrzeughaltern, Umweltorganisationen und Industrieverbänden, Feedback zu geben. Dieses Feedback wird dazu beitragen, den endgültigen Gesetzesvorschlag zu gestalten.
Der Bundesrat betont die Bedeutung eines fairen und nachhaltigen Finanzierungsmodells für die wichtigen Verkehrsnetze der Schweiz. Die Vorschläge zielen darauf ab, sicherzustellen, dass alle Strassenbenutzer gleichmässig zu der Infrastruktur beitragen, auf die sie täglich angewiesen sind.
Wichtige Termine
Ende der Vernehmlassungsfrist: 9. Januar 2026
Vorgeschlagener Besteuerungsbeginn: 2030
Das Bundesamt für Strassen (ASTRA) hat die Vernehmlassungsunterlagen auf seiner Website zur Verfügung gestellt. Diese Dokumente enthalten detaillierte Informationen zu beiden vorgeschlagenen Varianten und ihren potenziellen Auswirkungen.
Die Debatte um die Besteuerung von Elektrofahrzeugen ist eine globale, da viele Länder ähnliche Herausforderungen bei der Anpassung älterer Finanzierungsmodelle an neue Technologien bewältigen müssen. Der Ansatz der Schweiz spiegelt ein Engagement wider, eine hochwertige Infrastruktur aufrechtzuerhalten und gleichzeitig nachhaltige Mobilität zu fördern.