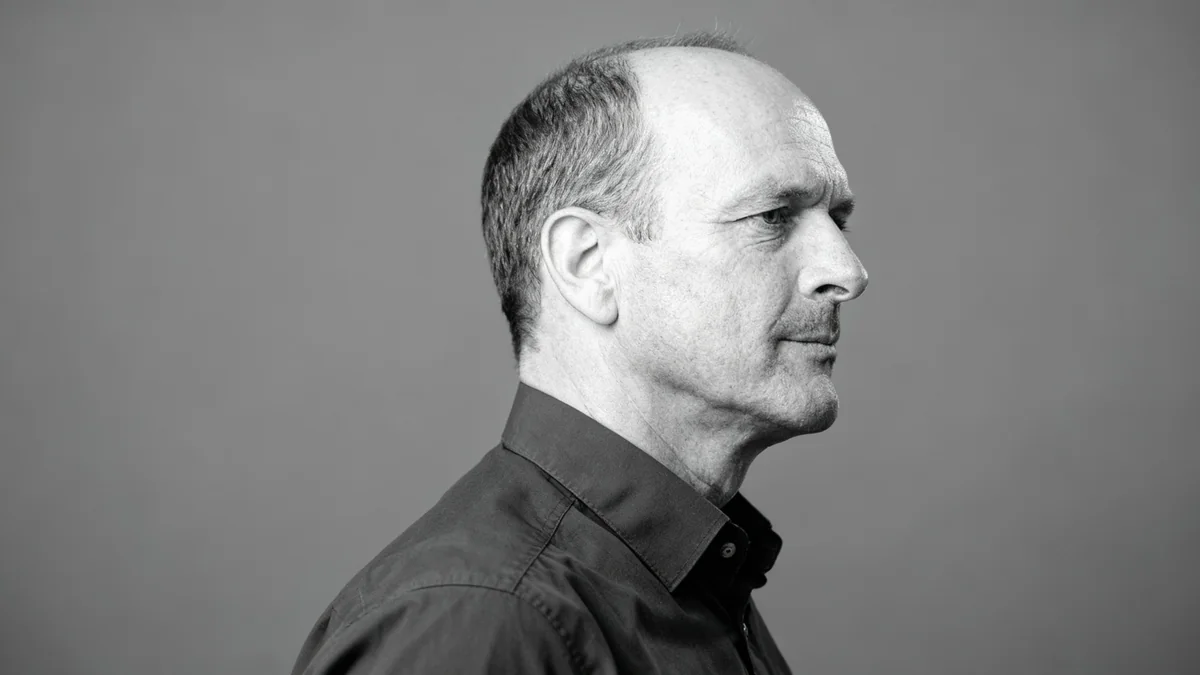Der Kanton Bern wird ein neues Gesetz zur Regulierung von Grossraubtierpopulationen, insbesondere Wölfen und Bären, einführen, das am 1. Februar 2026 in Kraft treten könnte. Diese Entwicklung folgt dem bedingten Rückzug einer Volksinitiative, nachdem das Kantonsparlament einen Gegenvorschlag genehmigt hatte, der dem Kanton grössere Befugnisse bei der Regulierung dieser Arten einräumt.
Die neue Gesetzgebung, die während der Septembersession des Grossen Rates verabschiedet wurde, ermöglicht es Bern, seine volle Rechtskapazität zur Populationskontrolle zu nutzen. Das Gesetz bleibt bis 2038 in Kraft und wird dann einer Überprüfung unterzogen. Seine Umsetzung hängt davon ab, dass kein erfolgreiches Referendum dagegen ergriffen wird.
Wichtige Erkenntnisse
- Ein neues Gesetz zur Regulierung von Grossraubtieren im Kanton Bern soll am 1. Februar 2026 in Kraft treten.
- Die Volksinitiative "Für einen Kanton Bern mit regulierbaren Grossraubtierbeständen" wurde bedingt zurückgezogen.
- Die neue Gesetzgebung konzentriert sich spezifisch auf die Regulierung von Wolfs- und Bärenpopulationen, ausgenommen Luchs und Goldschakal.
- Das Gesetz ermächtigt den Kanton, seinen bestehenden rechtlichen Spielraum für die Regulierung zu nutzen und verbietet Massnahmen, die das Wachstum der Raubtierpopulation fördern würden.
- Diese Bestimmungen gelten bis 2038, vorbehaltlich einer Überprüfung, um ihre Fortsetzung zu bestimmen.
Parlamentarischer Entscheid ebnet den Weg für neue Regelungen
Der Weg zum neuen Gesetz wurde während der Septembersession des Berner Grossen Rates geebnet. Während die Gesetzgeber die Volksinitiative mit dem Titel "Für einen Kanton Bern mit regulierbaren Grossraubtierbeständen" ablehnten, genehmigten sie gleichzeitig einen legislativen Gegenvorschlag. Dieser strategische Schritt bot dem Initiativkomitee eine praktikable Alternative, was zu deren Entscheidung führte, ihren ursprünglichen Vorschlag zurückzuziehen.
Laut einer Mitteilung der Staatskanzlei hatten die Initianten ihre Bereitschaft signalisiert, die Initiative zurückzuziehen, falls ein zufriedenstellender Gegenvorschlag angenommen würde. Der Parlamentsentscheid erfüllte diese Bedingung und verlagerte den Fokus von einer öffentlichen Abstimmung über die Initiative auf die Umsetzung des neuen Gesetzes.
Der neue Rechtsrahmen befindet sich nun in einer öffentlichen Vernehmlassungsphase. Wenn kein erfolgreiches Referendum von der Öffentlichkeit gegen das Gesetz ergriffen wird, tritt es automatisch am vorgeschlagenen Datum Anfang 2026 in Kraft.
Das Gesetzgebungsverfahren verstehen
In der Schweizer Politik ermöglicht eine Volksinitiative den Bürgern, Verfassungs- oder Gesetzesänderungen vorzuschlagen. Ein Gegenvorschlag ist ein gängiges parlamentarisches Instrument, bei dem die Regierung oder das Parlament ein alternatives Gesetz anbietet. Findet das Initiativkomitee den Gegenvorschlag akzeptabel, kann es seine Initiative zurückziehen, wodurch eine öffentliche Abstimmung vermieden und das neue Gesetz schneller in Kraft treten kann.
Definition des Umfangs der kantonalen Befugnisse
Der Kern der neuen Gesetzgebung besteht darin, die Befugnis des Kantons Bern zur Regulierung von Grossraubtierpopulationen innerhalb der Grenzen des Bundesrechts formell festzulegen. Befürworter der Massnahme argumentieren, dass der Bund zwar den übergeordneten Rahmen festlegt, die Kantone jedoch ein erhebliches Mass an Autonomie behalten, das rechtlich definiert und genutzt werden kann.
Das Gesetz besagt ausdrücklich, dass der Kanton seine rechtlichen Möglichkeiten zur Regulierung der Raubtierbestände ausschöpfen sollte. Dies ist eine direkte Reaktion auf wachsende Bedenken von Landwirtschafts- und ländlichen Gemeinden hinsichtlich der Auswirkungen von Wolfspopulationen auf Nutztiere und die öffentliche Sicherheit.
Verbot der Populationsförderung
Eine wichtige Klausel im neuen Gesetz spiegelt eine zentrale Forderung der ursprünglichen Initiative wider: Sie verbietet dem Kanton, Massnahmen umzusetzen, die das Wachstum von Grossraubtierpopulationen aktiv fördern würden. Diese Bestimmung stellt sicher, dass die kantonale Politik auf Management und Kontrolle statt auf naturschutzorientierte Expansion ausgerichtet ist, was für viele Bewohner in betroffenen Gebieten ein Streitpunkt war.
Zielarten: Wolf und Bär
Die Gesetzesänderungen konzentrieren sich eng auf zwei spezifische Grossraubtiere:
- Wolf (Canis lupus): Die primäre Art, die aufgrund ihrer wachsenden Population und vermehrter Sichtungen in landwirtschaftlichen Regionen Anlass zur Sorge gibt.
- Bär (Ursus arctos): Obwohl im Kanton seltener, umfasst das Gesetz Bären, um einen Rahmen für zukünftiges Management zu schaffen, falls ihre Zahlen zunehmen.
Bemerkenswerterweise gilt das Gesetz nicht für den Luchs oder den Goldschakal, deren Management weiterhin durch bestehende eidgenössische und kantonale Vorschriften geregelt wird.
Die Debatte über Wirksamkeit und Zuständigkeit
Das neue Gesetz wurde nicht ohne erhebliche Debatten im Grossen Rat verabschiedet. Der zentrale Streitpunkt drehte sich um die praktische Wirksamkeit eines kantonalen Gesetzes, wenn die Bundesgesetzgebung die Oberhoheit im Wildtiermanagement besitzt.
Gegner argumentierten, dass das Gesetz weitgehend symbolisch und unwirksam sei. Sie betonten, dass der Bund letztendlich die Bedingungen diktiert, unter denen geschützte Arten wie der Wolf erlegt werden können. Aus ihrer Sicht schafft das kantonale Gesetz falsche Hoffnungen, ohne neue, greifbare Instrumente zur Regulierung bereitzustellen.
"Die Gegner betonten, dass es unwirksam wäre, weil der Bund für die Regulierung der Grosswildpopulation zuständig ist", bemerkten politische Beobachter während der Parlamentssitzung.
Umgekehrt beharrten die Befürworter darauf, dass das Gesetz ein entscheidender Schritt sei. Sie argumentierten, dass es die kantonalen Behörden rechtlich dazu verpflichtet, proaktiv innerhalb ihrer Zuständigkeit zu handeln. Durch die Verankerung dieses Mandats im Gesetz stellt der Kanton sicher, dass alle verfügbaren rechtlichen Wege zur Regulierung von Wolfs- und Bärenpopulationen verfolgt werden, was Klarheit und eine klare Richtlinie für kantonale Behörden schafft.
Eine langfristige Strategie mit einer Sunset-Klausel
Die neuen Regelungen sind als langfristiges, aber anpassungsfähiges politisches Instrument konzipiert. Die Bestimmungen sollen über ein Jahrzehnt, bis 2038, in Kraft bleiben. Dieser erweiterte Zeitrahmen soll sowohl den Wildtiermanagementbehörden als auch der Landwirtschaft Stabilität und Vorhersehbarkeit bieten.
Die Aufnahme eines Überprüfungsdatums im Jahr 2038 fungiert jedoch als Sunset-Klausel. Dies bedeutet, dass das Gesetz nicht dauerhaft ist und basierend auf seiner Wirksamkeit und der ökologischen Situation zu diesem Zeitpunkt neu bewertet wird. Diese Überprüfung wird bestimmen, ob die Bestimmungen fortgesetzt, geändert oder auslaufen sollen, um sicherzustellen, dass die Politik sich an zukünftige Veränderungen der Raubtierpopulationen und der öffentlichen Meinung anpassen kann.
Dieser vorausschauende Ansatz berücksichtigt die dynamische Natur des Wildtiermanagements und zielt darauf ab, ein Gleichgewicht zwischen den unmittelbaren Bedürfnissen der Bevölkerung und der langfristigen ökologischen Gesundheit der Region zu finden.