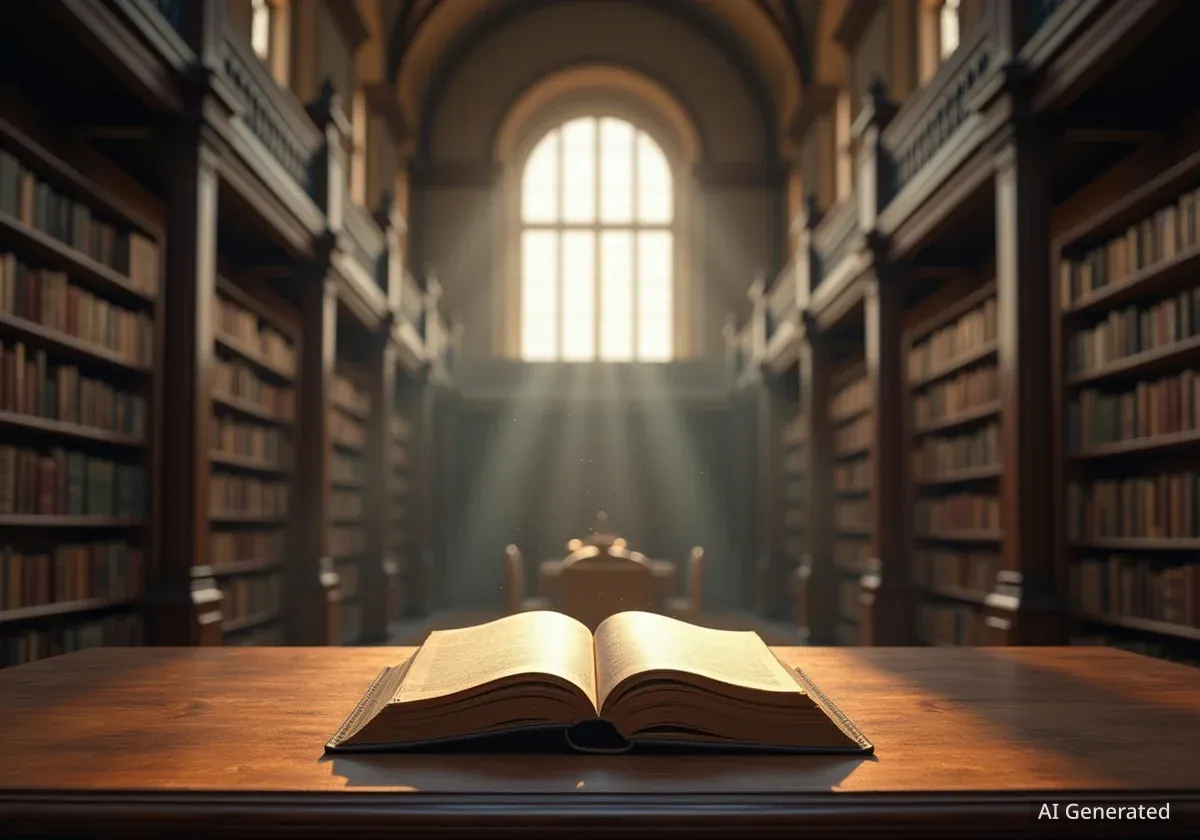Die Berner Produktion von Giacomo Puccinis Oper „Manon Lescaut“ an den Bühnen Bern hat aufgrund ihrer unkonventionellen Inszenierung erhebliche Diskussionen ausgelöst. Kritiker bemängeln eine Diskrepanz zwischen der musikalischen Partitur und der visuellen Erzählung auf der Bühne, was Fragen zur Interpretation des klassischen Werks durch die Regisseurin aufwirft. Während das Berner Sinfonieorchester und die führende Sopranistin gelobt wurden, wurde die künstlerische Gesamtleitung als problematisch beschrieben.
Wichtige Erkenntnisse
- Die Produktion von „Manon Lescaut“ an den Bühnen Bern weicht erheblich von Puccinis Originaloper ab.
- Die Inszenierung von Regisseurin Anna Bergmann schuf eine parallele Erzählung, die von der Musik ablenkte.
- Alevtina Ioffe, die neue Operndirektorin, führte das Berner Sinfonieorchester effektiv.
- Kiandra Howarth lieferte als Manon eine starke Gesangsleistung.
- Die Inszenierungsentscheidungen, einschließlich Kostüme und Videoelemente, wurden weithin kritisiert.
Eine divergierende Interpretation von Puccinis Klassiker
Giacomo Puccinis „Manon Lescaut“, 1893 uraufgeführt, war ein Schlüsselwerk für den Komponisten. Es markierte seinen ersten Durchbruch vor seinen berühmteren Opern wie „La Bohème“ und „Tosca“. Die Oper erzählt Manons Leben in vier Akten. Sie beginnt damit, dass sie sich in Amiens in den verarmten Chevalier des Grieux verliebt. Die Erzählung folgt ihr dann nach Paris, wo sie mit dem reichen Geronte de Ravoir lebt, ihrem Fluchtversuch mit des Grieux und ihrer schließlichen Deportation nach Louisiana, wo sie stirbt.
Die Produktion der Bühnen Bern unter der Regie von Anna Bergmann präsentierte jedoch eine drastisch andere visuelle Geschichte. Laut Kritikern wich die Inszenierung in drei der vier Akte vom Libretto ab. Dieser Ansatz führte zu einer parallelen Erzählung, die Puccinis ursprüngliche Musik und Handlung oft überschattete.
Opernfakt
Giacomo Puccini arbeitete vor der Premiere von „Manon Lescaut“ mit sieben verschiedenen Librettisten zusammen, was die komplexe Entwicklung der Operngeschichte verdeutlicht.
Inszenierungsentscheidungen ernten starke Kritik
Die ersten drei Akte der Berner Produktion zeigten eine Reihe ungewöhnlicher und verwirrender Inszenierungselemente. Dazu gehörten rot gekleidete Nonnen mit weißen Hauben, seltsame rituelle Szenen und ein Planschbecken auf einer Pariser Salonbühne. Studenten in der Oper wurden als Soldaten in Müllsack-ähnlichen Uniformen dargestellt. Im dritten Akt wurde ein Kran, der typischerweise mit einem Hafen assoziiert wird, als Galgen verwendet, und der Laternenanzünder agierte als Henker.
Die vielleicht bedeutendste Abweichung von der ursprünglichen Handlung ereignete sich im dritten Akt. Anstelle einer Deportation wurden Manon und des Grieux auf der Bühne erschossen. Sie erschienen dann im vierten Akt, wandernd durch eine leere, schwarz hinterlegte Bühne. Diese Wahl überließ es dem Publikum, zu erraten, ob die Ereignisse des letzten Akts ein Traum oder ein Albtraum waren, was zu erheblicher Verwirrung führte.
„Die Produktion ‚Manon Lescaut‘ an den Bühnen Bern hat nur eine marginale Verbindung zur eigentlichen Oper“, konstatierte ein Kritiker und hob das Ausmaß der Regieänderungen hervor.
Musik und Aufführung: Ein Lichtblick
Trotz der kontroversen Inszenierung erhielten die musikalischen Aspekte der Produktion positives Feedback. Der Abend markierte das Debüt von Alevtina Ioffe als neue Operndirektorin. Unter ihrem Dirigat spielte das Berner Sinfonieorchester Puccinis komplexe Partitur mit bemerkenswertem Können. Das Orchester fing Puccinis charakteristischen Klang, der von reich und kraftvoll bis zart und leicht reicht, erfolgreich ein. Puccinis komplexe Instrumentation ermöglichte mehrere starke Sololeistungen der Orchestermitglieder.
Vision der Regie
Moderne Opernproduktionen interpretieren klassische Werke oft neu. Regisseure können darauf abzielen, neue Themen hervorzuheben, traditionelle Ansichten in Frage zu stellen oder die Oper für ein zeitgenössisches Publikum relevant zu machen. Dieser Ansatz kann jedoch manchmal zu erheblichen Abweichungen vom Originalmaterial führen und Debatten unter Kritikern und Publikum auslösen.
Führende Sopranistin gelobt
Kiandra Howarth, die die Titelrolle der Manon übernahm, lieferte eine fesselnde Leistung. Ihre warme, klare und lebendige Stimme mit ihren sicheren Höhen war ein Höhepunkt des Abends. Howarth hatte das Publikum bereits im Berner Stadttheater in der Rolle der Arabella beeindruckt. Ihre Darstellung der Manon wurde als bedeutender Gewinn für die Produktion angesehen.
Der Tenor, der Howarth gegenüberstand, Andeka Gorrotxategi, erhielt eine gemischtere Kritik. Während seine Stimme Potenzial für eine heldenhafte, metallische Qualität zeigte, wurde sein Gesang oft als unkontrolliertes Forte-Display mit angestrengten Höhen beschrieben. Kritiker hofften, dies könnte eher auf Premierenfieber als auf ein konsistentes Stimmproblem zurückzuführen sein.
- Kiandra Howarth: Gelobt für ihre warme, klare und höhensichere Stimme als Manon.
- Alevtina Ioffe: Neue Operndirektorin, gelobt für ihre Führung des Orchesters.
- Berner Sinfonieorchester: Lieferte eine starke Leistung von Puccinis Partitur.
- Andeka Gorrotxategi: Tenor, dessen Leistung inkonsistent war, möglicherweise aufgrund von Premierenfieber.
Feministische Perspektive und fragmentierte Erzählung
Die Programmnotizen der Regisseurin deuteten auf eine „feministische Perspektive“ als Grundlage für die Neuinterpretationen hin. Kritiker argumentierten jedoch, dass die tatsächliche Inszenierung wenig mit Puccinis „Manon Lescaut“ zu tun hatte. Stattdessen schien sie stark von Margaret Atwoods dystopischem Roman „Der Report der Magd“ aus dem Jahr 1985 inspiriert zu sein. Dieser Einfluss war in Elementen wie den roten „Nonnen“ auf der Bühne offensichtlich.
Dieser Ansatz, so die Analyse, tat Puccinis Werk einen Bärendienst. Er trennte die musikalische Partitur effektiv von der Bühnenhandlung und entfernte jede sinnvolle Verbindung zwischen der Musik und den Charakteren oder der Handlung. Die Produktion behandelte Puccinis Partitur fast wie einen generischen Soundtrack und nicht als integralen Bestandteil der narrativen Struktur der Oper. Kritiker schlugen vor, dass, wenn eine feministische Interpretation das Ziel war, eine andere Oper, wie Poul Ruders' Oper „Der Report der Magd“, eine geeignetere Wahl gewesen wäre.
Visuelle Überladung
Die Produktion integrierte auch verschiedene Videoformate. Der erste Akt zeigte flackernde Fruchtbarkeitsslogans. Der zweite Akt projizierte Live-Großaufnahmen der Handlung auf die obere Hälfte der Bühne. Diese Elemente wurden als übertrieben und ablenkend empfunden und trugen zum Gesamteindruck einer überladenen und verwirrenden Präsentation bei.
Zukünftige Auswirkungen und Publikumsreaktion
Die Produktion läuft bis zum 31. Dezember 2025 im Stadttheater Bern. Die Entscheidung, „Manon Lescaut“ in dieser spezifischen Inszenierung für Silvestervorstellungen anzusetzen, wurde ebenfalls hinterfragt. Kritiker schlagen vor, dass die Bühnen Bern ihr Programm angesichts der stark polarisierenden Natur der aktuellen Produktion überdenken sollten.
Das Publikum, das das Theater verließ, äußerte Verwirrung und Unzufriedenheit. Die erheblichen Änderungen an der Handlung, kombiniert mit den oft bizarren visuellen Elementen, schufen ein Erlebnis, das viele nur schwer mit Puccinis Originaloper in Einklang bringen konnten. Die kritische Rezeption deutet auf die Notwendigkeit einer Neubewertung hin, wie klassische Werke interpretiert und präsentiert werden, insbesondere wenn die Inszenierung das Risiko birgt, das Publikum vom Kern des Musikdramas zu entfremden.
Es bleibt die Frage, ob solche radikalen Neuinterpretationen dazu dienen, das Opernerlebnis zu beleben oder zu schmälern. Für viele neigte die Berner Produktion von „Manon Lescaut“ zum Letzteren und hinterließ einen bleibenden Eindruck von verpassten Gelegenheiten und künstlerischer Übertreibung.